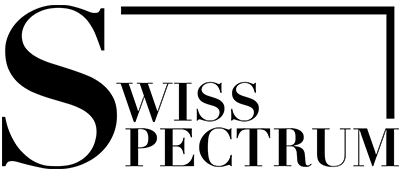Die wichtigsten Fakten zur einheitlichen Finanzierung von Gesundheitsleistungen
Am 24. November wird in der Schweiz über die einheitliche Finanzierung von Gesundheitsleistungen abgestimmt, gegen die die Gewerkschaft VPOD ein Referendum eingereicht hat. Heute werden von der Grundversicherung abgedeckte Gesundheitsleistungen unterschiedlich finanziert, je nachdem, ob es sich um stationäre oder ambulante Behandlungen handelt. Die Kantone tragen 55 Prozent der Kosten für stationäre Leistungen, während die Krankenkassen den Rest übernehmen. Für ambulante Behandlungen kommen die Kosten allein von der Krankenkasse.
Aufgrund des medizinischen Fortschritts sind mehr ambulante Behandlungen möglich, was zu steigenden Gesundheitskosten führt. Die im Dezember 2023 verabschiedete Efas-Vorlage («Einheitliche Finanzierung ambulant und stationär») sieht vor, dass die Kantone mindestens 26,9 Prozent und die Krankenkassen höchstens 73,1 Prozent der Kosten tragen. Die Integration der Langzeitpflege in die Vorlage war im Parlament umstritten, da zuvor Tarife ausgehandelt werden müssen.
Die Befürworter der Vorlage erwarten, dass sie falsche Anreize beseitigt, die Versorgung verbessert und jährlich bis zu 440 Millionen Franken einspart. Die Kantone wünschen den Einbezug der Langzeitpflege, da so die Kostenentwicklung in den Heimen mitgetragen wird. Die Gewerkschaft VPOD, unterstützt von Gewerkschaftsbund und Gewerkschaft Unia, hat das Referendum ergriffen und warnt vor Verschlechterungen für Pflegepersonal und Patienten.
Die Gegner der Vorlage befürchten, dass die Prämien weiter steigen werden, insbesondere aufgrund des Einbezugs der Langzeitpflege. Sie warnen davor, dass die Kantone ihre Verantwortung für die Pflege im Heim oder durch die Spitex aufgeben würden. Bundesrat und Parlament unterstützen die Vorlage, während Stimmen gegen sie vor allem von Mitgliedern der SVP, SP und Grünen kommen.